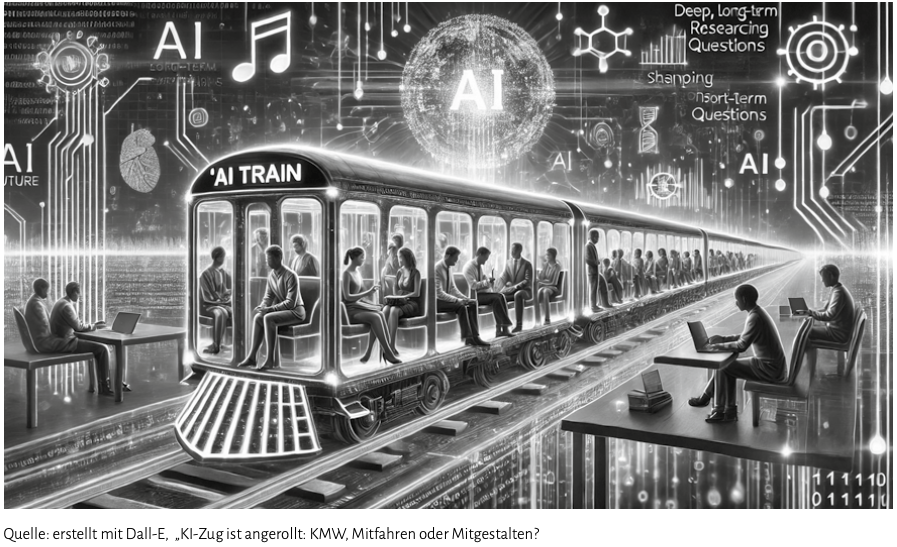Im KI-Zug mitfahren oder mitgestalten? Warum die Kommunikationswissenschaft Theorien und große Fragen, nicht bloß neue Phänomene braucht

Christian Schwarzenegger (Universität Bremen)
Die Kommunikations- und Medienwissenschaft ist es als Fach seit Jahrzehnten gewöhnt, sich rasend schnell an neue Entwicklungen anzupassen, dem Medienwandel zu folgen und sich mit ihrer Forschung in Tuchfühlung zu neuesten Technologien und Entwicklungen zu positionieren. Das ist auch angesichts kommunikativer künstlicher Intelligenz zunächst nicht anders. Technikfaszination und Hype-Akzeptanz kennzeichnen ein Fach, das in weiten Teilen sein historisierendes Bewusstsein auf das Altenteil entsorgt hat und sich in einem ewigen, nach vorne gerichteten Jetzt positioniert, um bereit zu sein, wenn das Jetzt das umfassende Morgen geworden ist. Leider kommt immer eine neue Neuigkeit dazwischen. Es ist noch nicht lange her, dass in Vorbereitung der Bremer Jahrestagung der DGPuK zur Automatisierung von Kommunikation – die ich noch nicht als Bremer, sondern als Fachgruppensprecher der Kommunikationsgeschichte mitverfolgte – skeptische Bedenken in der Runde der Fachgruppensprecher:innen vorgebracht wurden: das Thema sei nischig, niemand würde dazu arbeiten, die Relevanz sei fragwürdig, die Chance, die jeweils vertretene Fachgruppe in der Obskurität wiederzufinden, gering.
Dann zündete das Release von ChatGPT einen regelrechten Run auf das Thema. Die Leute kamen aber, von wo sie eben noch gestanden waren, d. h. mit denselben Fragen, denselben methodischen Instrumenten und demselben theoretischen Rüstzeug: neu war nur der Gegenstand, auf den die Erkenntnisinteressen nun projiziert wurden, aber nicht aus dem Phänomen abgeleitet oder für dieses entwickelt. Kurze Zeit später war da das Bild des Papstes in seinem imposanten weißen Mantel und ein Donald Trump auf der Flucht vor der Polizei – für viele inhaltlich ein Wunschszenario, für andere ganz klar wissenschaftlich das nächste große Ding. Und selbstverständlich ist es angemessen, dass wir danach fragen, was hier gerade passiert, wie und ob die Möglichkeiten, die mit niederschwelligen Bildgeneratoren in die Welt kommen, nicht weitreichende epistemische Krisen auslösen, das Verhältnis des Menschen zum Bild, die bildliche Evidenzkraft und bildbezogene Praktiken komplett umstoßen werden. Es ist wichtig, dass wir als Fach hier mit dabei sind und uns beteiligen – als Teil einer wunderbar produktiven Arbeitsgruppe zu generativen Bildern am CAIS und mit Studien zum Gebrauch generierter Bilder durch die extreme Rechte habe ich das auch getan und dabei viel gelernt.
Eine Lektion, die sich dabei aber auch einstellte, war: viele der Fragen, die wir an das Phänomen heute stellen, lassen sich nur formulieren, weil es eben neu ist und wir noch keine Routine damit haben, sowohl was Praktiken des Umgangs mit den Bildern als auch deren Erforschung betrifft. Aber in wenigen Jahren, vielleicht auch nur Monaten handelt es sich dabei nicht mehr um uncharted territories. Vor allem wird das Phänomen KI-generierter Bilder so präsent, so alltäglich in der Schwemme digitaler Visualität sein, dass die Neuigkeit allein kein Interesse mehr begründet, der Umstand, dass die Bilder generiert sind, keinen Erklärwert mehr bringt und als Antwort nicht taugt. An welchen Bildfehlern erkennen wir synthetische Bilder?, Täuscht KI-Bildpropaganda besser oder anders?, Was kann man noch glauben, wem vertrauen?: Fragen wie diese werden sich neu und anders stellen, manche davon überdauern, aber viele auch ganz verschwinden. Die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit von Transformationsprozessen ist dabei im Tagesgeschäft vernachlässigbar, wenn man erfolgreich publizieren will – und das ist ein Problem. Denn es erlaubt uns immer wieder an den neuesten Phänomenen zu operieren, ohne uns wirklich auf diese einzulassen oder theoretisch über die Neuigkeit hinaus rechtfertigen zu müssen, warum wir denn auf den Zug aufspringen.
Der KI-Zug ist angerollt, wichtig wird sein, ob wir nur mitfahren, um mitgenommen zu werden, oder auch eine Idee davon entwickeln, wo die Reise hingehen soll und wie wir diese gestalten wollen. Die Forschungscommunity steht vor der anspruchsvollen Aufgabe, sich mit tiefgreifenden, bedeutsamen Fragestellungen auseinanderzusetzen, die neben kurzfristigen Gratifikationen auch langfristige Relevanz entwickeln können. Dafür braucht es neben einer breiten empirischen Basis vor allem auch theoretische Zugänge und Konzepte, die zu fassen helfen, was eigentlich neu und spezifisch ist, und neue Phänomene wie synthetischen Bilder in größere Zusammenhänge stellen und größere gesellschaftliche Fragen zu stellen, als wir das oft gewohnt sind. Nur so können wir uns sinnvoll und substanziell in gesellschaftliche Debatten einbringen, sofern wir das denn wollen.